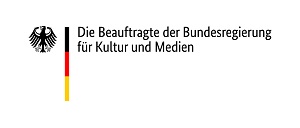Blog

In Uniform mit Pickelhaube: Helmuth Graf von Moltke (1800 – 1891), preußischer Generalfeldmarschall. Gemälde von T. Lange, Deutschland, um 1900, Öl auf Leinwand (Bismarck-Museum Friedrichsruh, Inventar.-Nr.: A 367)
Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke trat 1811 in das dänische Heer als Kadett ein und wechselte 1822 zur preußischen Armee. Von 1823 bis 1826 besuchte der talentierte junge Offizier die Kriegsakademie in Berlin. 1833 erfolgte seine Berufung in den Großen Generalstab. 1836 wurde er als Militärberater für die Reorganisation der türkischen Armee in das Osmanische Reich abkommandiert und nahm an Feldzügen gegen die Kurden sowie in Ägypten teil (1838/39). Ende 1845 wurde Moltke kurzzeitig Adjutant des Prinzen Karl Heinrich von Preußen (1781 – 1846). 1847 zum Generalstab des VII. Armeekorps (Koblenz) versetzt, diente er nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin von 1848 bis 1855 als Chef des Generalstabs des IV. Armeekorps (Magdeburg). 1855 ernannte ihn der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm (1831 – 1888) zum Adjutanten, 1857 zum Generalmajor befördert, übernahm Moltke die Leitung des Großen Generalstabs, zu dessen Chef er offiziell 1858 avancierte. 1866 wurde Moltke zum General ernannt und erhielt als Generalstabschef die Kompetenz, dem Heer im Namen des Königs ohne vorherige Konsultation des Kriegsministers Befehle zu erteilen. Das ermöglichte Moltke, im Gefecht militärische Operationen unmittelbar zu leiten.
Die Siege in den Kriegen gegen Dänemark (1864), Österreich (1866) und Frankreich (1871) gehen maßgeblich auf seine Operationspläne zurück. Noch während des Frankreichfeldzuges wurde er von König Wilhelm I. in den Grafenstand erhoben. Am 16. Juni 1871 erfolgte schließlich seine Beförderung zum Generalfeldmarschall. Von 1867 bis zu seinem Tod war er zudem für die Konservativen Abgeordneter des Norddeutschen sowie des Deutschen Reichstags und seit 1872 auch Mitglied des Preußischen Herrenhauses. 1888 wurde er auf eigenen Wunsch von Kaiser Wilhelm II. (1859 – 1941) von seinen Pflichten als Chef des Generalstabs entbunden. Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges warnte Moltke wiederholt vor den zerstörerischen Folgen eines alle Ressourcen verschlingenden Volkskriegs in Europa.

Das Bismarck-Denkmal in Aumühle (Ausschnitt), © Otto-von-Bismarck-Stiftung
Seitdem der Bundestag und die Hamburgische Bürgerschaft 2014 beschlossen haben, das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark zu sanieren, wird in Hamburg intensiv über einen zeitgemäßen Umgang mit dieser Rolandsfigur diskutiert. Weniger öffentlichkeitswirksam, aber nicht minder kontrovers hatte bereits Jahrzehnte zuvor in Aumühle eine ähnliche Diskussion über gleich zwei ‚Steine des Anstoßes‘ eingesetzt, die mit dem Namen des ersten Reichskanzlers verbunden sind: ein Bismarck-Denkmal, das sein österreichischer Verehrer Georg von Schönerer 1921 gestiftet hatte, sowie dessen Grabstätte, die ein Jahr später auf dem Aumühler Friedhof eingerichtet worden war.

Großes Fest im Schloss Versailles, das seit 1837 Nationalmuseum ist. Kolorierter Stahlstich von Charles Rolls (1799 –1885), nach Eugene Louis Lami (1800 –1890), Großbritannien, 1843 (Otto-von-Bismarck-Stiftung, Inventar-Nr.: ZSg 2751)
Auf diesem Fest in Versailles war die feminine „Stundenglas-Silhouette“ unverkennbar angesagt. Der 1843 gedruckte Stich verrät aber nicht nur etwas über Stoffe und Schnitte, sondern vermittelt mit der Mode seiner Zeit auch Hinweise auf die Rolle, die den Damen der Gesellschaft zugewiesen wurde.